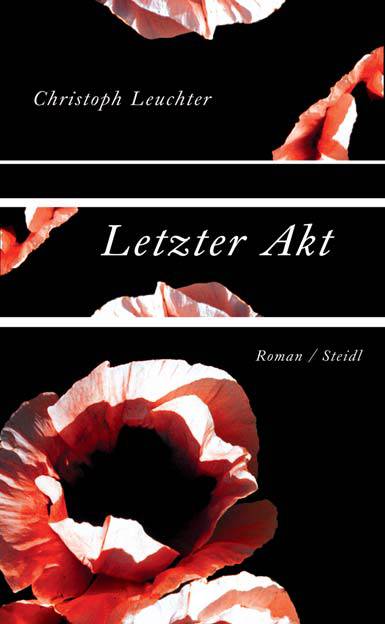Letzter Akt
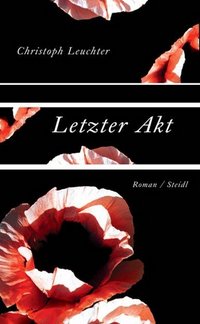
Ein kleines Dorf in der Toskana, genauer: ein Dorf in der Nähe von Florenz. Nicht Fiesole, das wäre zu nah. Dorthin schwappt noch das Städtische, das Kulturelle, dorthin zieht es die Touristen. Das Dorf, um das es hier geht, könnte zwanzig bis dreißig Kilometer von Florenz entfernt liegen. In dieser Gegend sind Hinweisschilder am Straßenrand meist ungenau, und der Name des winzigen Ortes steht ohnehin nirgends. Als hätte man ihn einfach vergessen oder gutwillig von der Landkarte gestrichen.
Der Weg ist alles andere als leicht zu finden, dafür birgt er zu viele unerwartete Abzweigungen, und das letzte Stück ist völlig unbefestigt. Für gewöhnlich will ja auch niemand dorthin. Wenn aber plötzlich eine Leiche in einem Schuppen hängt, dann ändert sich das schlagartig.
Weil es sich um ein vergessenes Dorf handelt, leben dort beinahe nur alte Menschen. Die Jungen sind längst fortgegangen in die Städte, wo das Leben brodelt. Und so vergessen und sich selbst überlassen wirken die Figuren wie aus einer anderen Zeit: die alte Maddalena, noch viel älter als alle anderen; der Lehrer ohne Schüler; der todkranke Apotheker Barelli mit seiner divenhaften, immer noch schönen Frau; Pater Giuseppe, ein gestrandeter Pfarrer mit Talent zum Automechaniker, und nicht zuletzt der Tischler, Paolo Veronese, den alle für einen Künstler halten.
Mit diesen Hinweisen auf seine Bewohner ist der Ort zwar nur grob umrissen, doch besser getroffen als mit einer Beschreibung der Häuser, Straßen oder Plätze. Aber Figuren machen noch keine Geschichte. Es fehlt der entscheidende Anstoß, das Motiv. Warum soll man eine Geschichte aus der tiefsten toskanischen Provinz erzählen? Und dieses Motiv liegt, wenn man es genau nimmt, ebenfalls in einer Figur: einem deutschen Professor, seit einigen Jahren emeritiert, der sich in Bezug auf sein Alter kaum von den übrigen Dorfbewohnern unterscheidet. Diese nennen ihn Di Landa, wegen der großen Wiese hinter der sogenannten Professoren villa, oder weil sie seinen Namen der Einfachheit halber ins Italienische übertragen haben. Ursprünglich hieß Di Landa einmal Martin Vonderheid, geboren 1914 in Berlin.
Jetzt ist er sechsundsiebzig Jahre alt. Die Welt versucht sich gerade auf ihre neuen Bedingungen einzustellen, auf die veränderten politischen Verhältnisse, das Ende der Ideologien. Nach dem Fall der Mauer ist Deutschland in den Mittelpunkt der Betrachtungen geraten, zumindest der europäischen. Mancherorts sieht man mit Hoffnung und Freude auf das ehemals geteilte Land, andernorts mit Skepsis und Furcht, überall mit Neugierde. Doch in dem toskanischen Dorf scheinen diese Dinge belanglos zu sein. So sehr die germanische Abstammung des Professors möglicherweise zu Beginn ein Nachteil war, so wenig gereicht sie ihm jetzt zum Vorteil. Völlig ungeachtet weltgeschichtlicher Ereignisse ist Di Landa mittlerweile ein akzeptiertes Mitglied der Dorfgemeinschaft, was an seiner ruhigen und bescheidenen Art liegen mag, vielleicht auch an seinem fast makellosen Italienisch, ganz sicher aber an seiner höchst makel losen Frau: Marie ist Französin und obendrein mehr als dreißig Jahre jünger als der Professor. Sie ist die eigentliche Attraktion des vom Aussterben bedrohten Ortes. Neben Di Landa und den übrigen Alten sieht Marie mit ihren zweiundvierzig Jahren wie ein junges Mädchen aus.
Vor knapp zehn Jahren haben die beiden das Haus am Rande der großen Wiese gekauft von einem niederländischen Lottomillionär. Der verließ »dieses Wachsfigurenkabinett inmitten der Hügel und Wälder« und zog in eines der lieblichen Weindörfer in der Gegend von Siena. Zuvor hatten Di Landa und Marie in Paris gelebt, wo der Professor mittelalterliche Literatur unterrichtete, französische wie italienische. Nun hält er nur noch ab und an Vorlesungen an der Universität von Florenz, lebt ansonsten aber das beschauliche Leben eines Privatgelehrten im Ruhestand.
Die Wiese, gleich hinter dem Haus, führt über die Distanz eines Fußballfeldes zu einem hinfälligen Schuppen, beinahe ein Häuschen. Es steht direkt vor den ersten Bäumen des angrenzenden Olivenhains. Mindestens einmal am Tag schreitet Di Landa die Wiese in Richtung des Schuppens ab, bei jedem Wetter. Auch jetzt geht er schweren Schrittes wieder diesen täglichen Weg. Er trägt einen nicht mehr neuen schwarzen Anzug, darunter ein weißes Hemd ohne Krawatte. Die Füße stecken in ramponierten Pantoffeln, was möglicherweise der frühen Uhrzeit geschuldet ist. Die Morgensonne lässt das schüttere Haar auf dem etwas zu kleinen Kopf wie silbrig glänzende Spinnweben erscheinen. Wenn Di Landa nicht gerade in das helle Licht blinzelt, ist das klare Blau seiner Augen zu erkennen, fast so wässrig wie der Himmel an diesem gerade erwachenden Samstag im März.